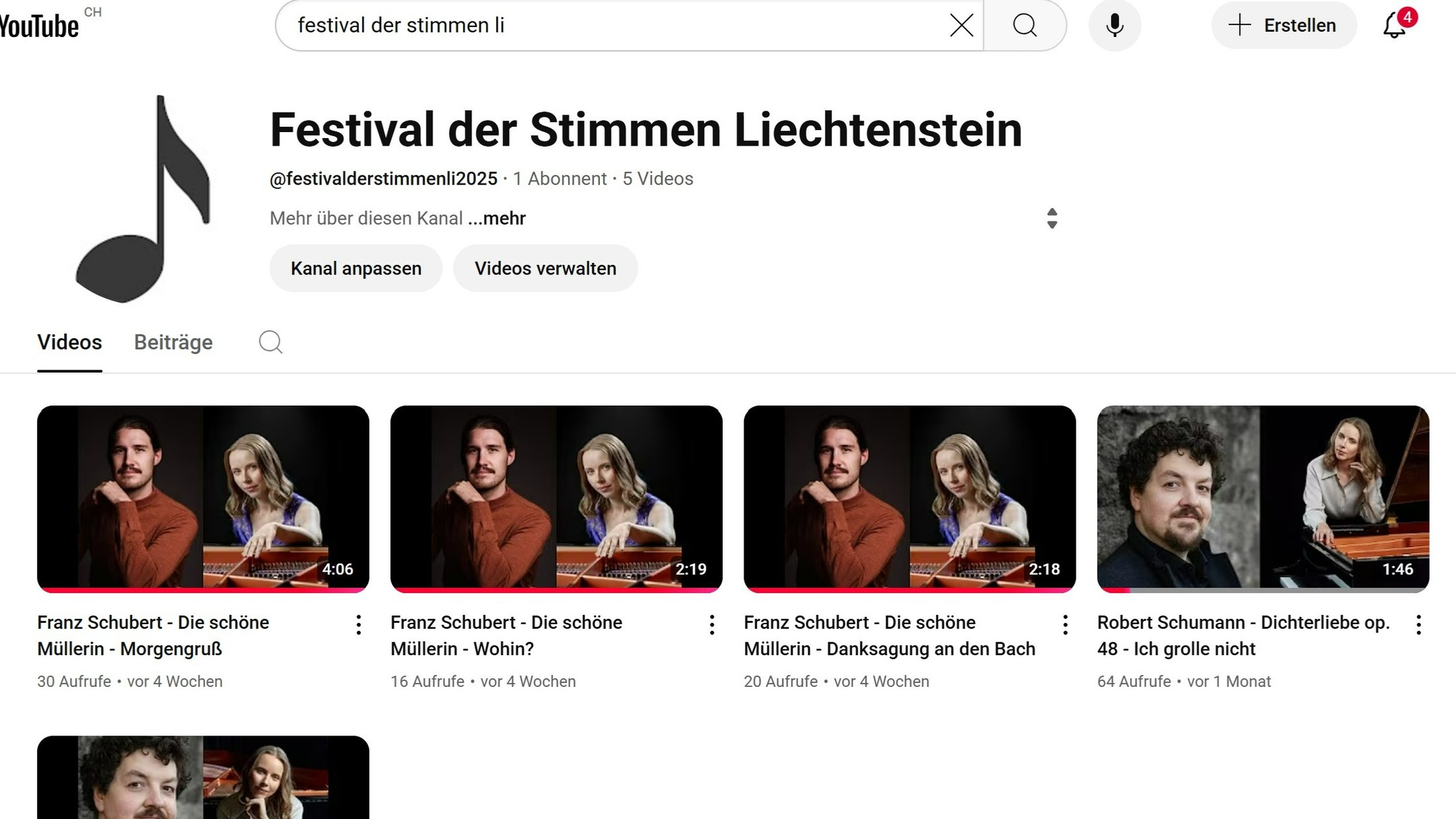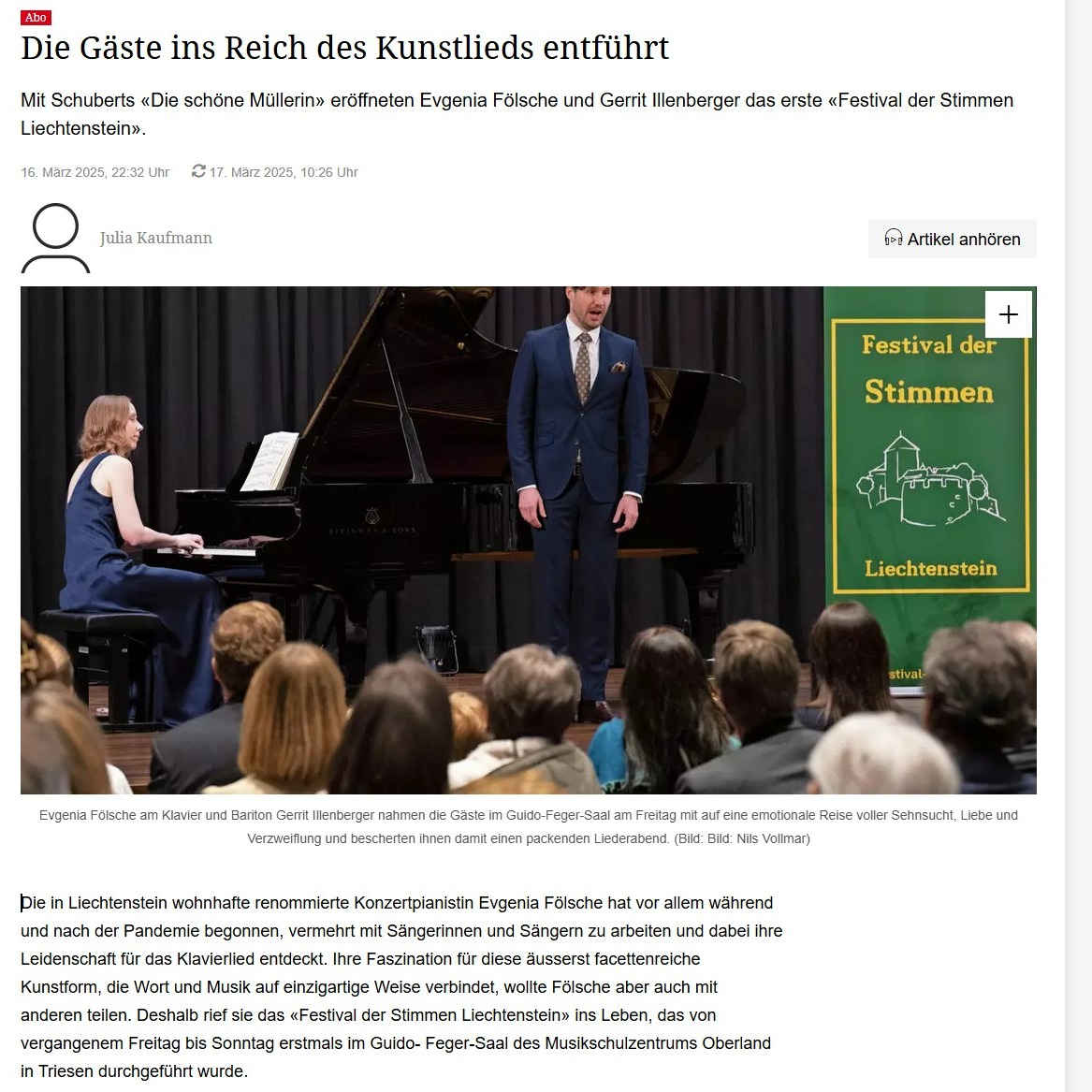Jenseits des deutschsprachigen Kunstlieds haben sich im 19. und 20. Jahrhundert eigenständige nationale Liedtraditionen ausgebildet. Frankreich kultiviert die mélodie, Italien die romanza da salotto, Spanien die canción lírica/canción de concierto, Russland den romans, und in England entsteht eine reiche English art song-Kultur. Der folgende Überblick beschreibt historische Linien, ästhetische Kennzeichen sowie zentrale Komponisten und Werkbeispiele – ergänzt um nord- und osteuropäische Beiträge.
Frankreich: Mélodie
Die französische mélodie ist das art song-Pendant zum deutschen Lied, historisch im 19./frühen 20. Jahrhundert verankert. Sie verbindet ernsthafte Lyrik mit einer fein nuancierten Klaviersprache; frühe Verwendung des Begriffs bezieht sich auf die französische Rezeption Schuberts.[1] Ästhetisch prägen Prosodie-Feinsinn, farbenreiche Harmonik und eine enge Verzahnung von Textsilbe und musikalischer Geste; maßgebliche Linien führen von Berlioz über Fauré, Duparc und Debussy bis Ravel und Poulenc.[2][3]
Prägende Komponisten & Werke
- Gabriel Fauré – Zyklen und Einzelmelodien (u. a. La bonne chanson); stilbildend für die feinsinnige, prosodisch bewegliche Mélodie.[4]
- Claude Debussy – 57 veröffentlichte Lieder; Verschmelzung von deklamatorischem Sprechen und lyrischem Gesang, das Klavier als formbildender Partner.[5]
- Francis Poulenc – u. a. Banalités (Hôtel), exemplarisch für Wortwitz und Klangimagination.[6]
Referenzliteratur: Graham Johnson/Richard Stokes, A French Song Companion (OUP).[7]
Italien: Romanza da salotto
Die italienische romanza da salotto (Salonromanze) blüht im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie ist stärker „kantabel-lyrisch“ und häufig unmittelbar gefühlsbetont, mit deutlichem Opernbezug, zugleich aber für Stimme und Klavier gedacht. Zentrale Figur ist Francesco Paolo Tosti, dessen Romanzen internationalen Zuspruch fanden (auch in London).[8][9][10]
Prägende Komponisten & Werke
- F. P. Tosti – u. a. Ideale, L’alba separa dalla luce l’ombra, ’A vucchella; typisches Repertoire der romanza mit großer melodischer Direktheit.[10]
- Luigi Gordigiani – „lo Schuberto italiano“, ein früher Wegbereiter der italienischen Salonkultur.[11]
- Historisch populär: Musica proibita (S. Gastaldon) – emblematisches Beispiel der Gattung.[12]
Forschung und Überblicksdarstellungen zur italienischen romanza geben Sanvitale (Istituto Nazionale Tostiano) u. a.[11]
Spanien: Canción lírica / Canción de concierto
Die spanische Tradition des Konzertlieds (canción lírica, teils canción de concierto) vereint regionale Idiome (kastilisch, katalanisch etc.) mit pianistisch farbiger Begleitung. Bedeutend sind Sammlungen, die Volks- und Kunstlyrik kunstvoll verarbeiten, etwa Fernando Obradors’ vier Bände Canciones clásicas españolas (1921–1941).[13][14] Katalanische Liedkunst ist u. a. mit Eduard Toldrà präsent (Liedzyklen, enge Verbindung zur katalanischen Sprache und Noucentisme-Ästhetik).[15][16]
Prägende Komponisten & Werke
Russland: Romans (русский романс)
Der russische romans ist eine Gattung intimer lyrischer Lieder für Singstimme und Klavier, mit Wurzeln im 19. Jahrhundert. Früh prägen Alyabyev, Varlamov, Gurilev und später Glinka die Form; im späten 19. Jh. setzen Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Rachmaninow und andere markante Akzente. Die Forschung verortet den romans zwischen klassischer und volkstümlicher Tradition, mit Phasen salonhafter „Romanze“ und späteren Wandlungen im 20. Jahrhundert.[18][19][20]
Prägende Komponisten & Werke
- P. I. Tchaikovsky – 6 Romances u. a.; lyrische, melodisch reiche Vokalsprache.[21]
- S. Rachmaninow – ausgedehntes Liedœuvre, pianistisch substanzielle Begleitungen.
- N. Rimsky-Korsakov – Liedschaffen als wenig bekannte, ästhetisch bedeutende Seite seines Werks.[22]
Zur historischen Einbettung russischer Musik (vom Volks-/Kirchenkontext zur westlich geprägten Gattung) vgl. Länderartikel.[23]
England: English Art Song
Die englische Kunstliedkultur entfaltet sich im späten 19. und 20. Jahrhundert mit eigenem Klangideal (englische Sprachprosodie, Folk-Idiome, modale Färbungen). Neben frühromantischen Vorläufern (Parlour Song) prägen im 20. Jahrhundert Ralph Vaughan Williams, George Butterworth, Roger Quilter, John Ireland u. a.; später setzt Britten hochartifizielle zyklische Maßstäbe.[24][25]
Prägende Komponisten & Werke
- R. Vaughan Williams – u. a. The House of Life; Verbindung von Folksong-Tradition und kunstliedhafter Faktur.[24]
- G. Butterworth – A Shropshire Lad (Auszüge) – Inbegriff des pastoralen Tons.
- R. Quilter – elegante, textklare Liedsprache.[25]
- B. Britten – Zyklen wie Songs and Proverbs of William Blake (hohe textliche und pianistische Kunst).[26]
Norden & Osten: Norwegen, Finnland, Böhmen u. a.
Norwegen (Grieg)
Edvard Grieg gilt als herausragender norwegischer Liedkomponist; sein Stil verbindet volksliednahe Einfachheit mit kunstvoller Klavierpoesie.[27] Das Liedschaffen speist sich aus verschiedenen Sprachen (u. a. norwegisch, deutsch) und prägt eine eigenständige nordische Klangsprache.[27]
Finnland (Sibelius)
Jean Sibelius schuf über einhundert Lieder für Singstimme und Klavier, vielfach auf schwedische Texte – mit charakteristischer dunkler Klangpoesie und konzentrierten Klaviersätzen.[28][29]
Böhmen/Tschechien (Dvořák u. a.)
Antonín Dvořák verbindet im Lied die böhmisch-mährische Idiomatik mit romantischer Kunstliedform; kulturhistorisch stehen seine Zyklen in einem Umfeld starker nationaler Selbstvergewisserung.[30][31]
Weitere Länder (Polen, Ungarn …)
In Polen (z. B. Chopins 17 Polnische Lieder op. 74), Ungarn (Kodály, Bartók frühe Lieder) oder Skandinavien insgesamt entwickelt sich eine vitale Liedkultur, die jeweils Volksidiome künstlerisch in Klaviersatz und Prosodie integriert (grundsätzlicher Überblick: Art Song als Gattungsrahmen).[32]
Quellen (Auswahl, mit Links)
- Britannica: Mélodie (französisches Kunstlied). Link. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Britannica: Song – Abschnitte zu französischem Lied (Fauré, Debussy). Link. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Hal Leonard: „20th Century French Art Songs“ – Überblick/Einführung. Link. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Ober, M. E. (2012): Fauré’s Mélodies (Diss.). PDF. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Britannica: Vocal music – The repertory since 1600 – Mélodie-Kontext (Berlioz, Debussy, Ravel). Link. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Oxford Song: Poulenc, Hôtel (Banalités). Link. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- OUP: Johnson/Stokes, A French Song Companion. Link. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- Bloomsbury: Romanza da salotto (Begriff & Kontext). Link. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Britannica (Students): Francesco Paolo Tosti – Biografisches. Link. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- Wikipedia: Paolo (Francesco) Tosti – Werküberblick (Romanzen). Link. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- ResearchGate: Gordigiani & Literatur zur italienischen romanza. Link. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Wikipedia: Musica proibita – Beispiel der romanza da salotto. Link. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
- IMSLP: Obradors, Canciones clásicas españolas (Bd. 1). Link. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- Oxford Song: Canciones clásicas españolas (Serienseite). Link. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- UNCG (2009): Toldrà – Sprache, Text & Musik (Studie). Link. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
- MusicWeb International: Toldrà-Songs (Besprechung). Link. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- Britannica: Joaquín Rodrigo – Kontext spanischer Kunstmusik im 20. Jh. Link. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- Wikipedia: Russian romance – Überblick zur Gattungsgeschichte. Link. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
- Oxford (ORA): Bullock (2019), Entstehung der sowjetischen Romanze (Studie). PDF. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
- Academia/Journal: Guseynova – Synthese von klassischer und Volksmusik im romans. Link. :contentReference[oaicite:19]{index=19}
- Oxford Song: Tschaikowsky, 6 Romances. Link. :contentReference[oaicite:20]{index=20}
- Interlude: Rimsky-Korsakov & der russische romans. Link. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
- Britannica: Russland – Musik (Übersichtsartikel). Link. :contentReference[oaicite:22]{index=22}
- Oxford Song: Ralph Vaughan Williams (Komponistenseite). Link. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
- La Scena Musicale: Einführung britisches Art Song (20. Jh.). Link. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
- Album: Britten & Vaughan Williams (Beispiel zyklischer Repertoirepflege). Link. :contentReference[oaicite:25]{index=25}
- Britannica: Art songs in other Western countries – Grieg & Sibelius. Link. :contentReference[oaicite:26]{index=26}
- LA Phil/Hollywood Bowl: Sibelius – Lieder (Zahlen/Entstehung). Link. :contentReference[oaicite:27]{index=27}
- Britannica: Jean Sibelius – Biografie (Kontext). Link. :contentReference[oaicite:28]{index=28}
- Hampsong Foundation: „Antonín Dvořák and the Songs of His Time“. Link. :contentReference[oaicite:29]{index=29}
- Wikipedia: Dvořák – Werkverzeichnis (Liedgattungen im Kontext). Link. :contentReference[oaicite:30]{index=30}
- Britannica: Art song – Gattungsdefinition & Abgrenzung. Link. :contentReference[oaicite:31]{index=31}
Alle Links zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2025. Die Auswahl kombiniert Standardreferenzen (Britannica/OUP/LA Phil/Oxford Song), einschlägige Forschungsarbeiten sowie Repertoire-/Quellenportale (IMSLP, Hampsong).